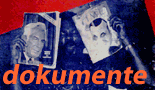| |
"Welcome to Gods country" grüßt ein Schild am Straßenrand Reisende im
südlichesten Zipfel des Bundesstaates Pennsylvania. Neben jeder kleinen
Ansiedlung findet sich hier ein Gotteshaus. Seitdem es mit dem heimischen
Kohlebergbau bergab ging, leigt die Arbeitslosigkeit in der Region weit
über dem Durchschnitt der USA. Nur in der Kreisstadt Waynesburg sorgt
ein Hochsicherheitsgefängnis mit über 1000 Gefangenen für einen bescheidenen
wirtschaftlichen Aufschwung.
Der weitläufige Gebäudekomplex versteckt sich hinterhohen Stacheldrahtrollen,
zwischen denen geharkte Sandstreifen jeden Fußabdruck zeigen. Die Anlage
mit den Wachtürmen, in denen Wärter mit Schußwaffen patroullieren, erinnert
an den Todesstreifen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Besucher
werden durch endlose Gänge eskortiert. "Welcome to Hell - Willkommen in
der Hölle", sagt Mumia Abu-Jamal, als ein Aufseher die Glastür zu einer
kleinen Besucher zelle öffnet. Genau zwei Stunden Zeit sind ihm eingeräumt,
um sein Leben "in der Hölle des Todestrakts von Waynesburg" zu beschreiben.
Hier ist die Mehrheit der insgesamt 226 Todeskandidaten des Bundesstaates
Pennsylvania inhaftiert. Über die Hälfte von ihnen sind Afroamerikaner,
deren Anteil an der Gesamtbevölkerung des Bundesstaates knapp neun Prozent
beträgt. Der heute 45jährige ehemalige Black Panther und Radio-journalist
Abu-Jamal ist einer von ihnen. Er wurde 1982 wegen Mordes an einem weißen
Polizisten zum Tode verurteilt.
 Der
übliche Handshake zur Begrüßung entfällt. Stattdessen klopft der hochgewachsene
Mann in dem verwaschenen schwarz-weiße gestreiften Overall mit den Handschellen,
die seien Hände umklammern, gegen die dicke Sicherheitsglasscheibe. Jeder
direkte Kontakt zwischen Todeskandidaten und Besuchern ist unmöglich.
Ausnahmen gibt es nicht. Abu-Jamal, dreifacher Vater und inzwischen schon
Großvater, sagt, für die Sehnsucht, nach 17 Jahren im Todestrakt eine
vertraute Person anfassen zu dürfen, fände er kaum Worte. "Was bleibt,
sind Träume." Über Gefühle zu reden ist gefährlich in einer Umgebung,
in der jedes Wort mitgehört und "gegen dich verwandt" werden kann. So
wie 1995, als die Gefängnisleitung zugeben mußte, dass sie über Monate
den Schriftverkehr zwischen Abu-Jamal und seinen Anwälten kopiert und
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hatte. Der
übliche Handshake zur Begrüßung entfällt. Stattdessen klopft der hochgewachsene
Mann in dem verwaschenen schwarz-weiße gestreiften Overall mit den Handschellen,
die seien Hände umklammern, gegen die dicke Sicherheitsglasscheibe. Jeder
direkte Kontakt zwischen Todeskandidaten und Besuchern ist unmöglich.
Ausnahmen gibt es nicht. Abu-Jamal, dreifacher Vater und inzwischen schon
Großvater, sagt, für die Sehnsucht, nach 17 Jahren im Todestrakt eine
vertraute Person anfassen zu dürfen, fände er kaum Worte. "Was bleibt,
sind Träume." Über Gefühle zu reden ist gefährlich in einer Umgebung,
in der jedes Wort mitgehört und "gegen dich verwandt" werden kann. So
wie 1995, als die Gefängnisleitung zugeben mußte, dass sie über Monate
den Schriftverkehr zwischen Abu-Jamal und seinen Anwälten kopiert und
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hatte.
Je nach politischer Gesinnung der Kommentatoren gilt der Mann mit der
tiefen Radiostimme als "kaltblütiger Polizistenmörder" oder "Stimme der
Unterdrückten". Keinem anderen der landesweit 3500 Todeskandidaten ist
in den letzten Jahren soviel internationale Aufmerksamkeit zuteil geworden
wie Abu-Jamal. Amnesty Internationals Präsident Pierre Sane und Danielle
Mitterand haben ihn besucht, das Vorgehen der Justiz angeprangert und
ein neues Verfahren verlangt. Demonstranten fordern immer wieder vor US-Botschaften
seine Freilassung.
Jeder Besuch sei "wie ein Fenster zur Welt", sagt Abu-Jamal, der lieber
die Rollen tauschen und den Besuch über die Menschenrechtspolitik der
Bundesrepublik ausfragen möchte. Nur zögernd spricht er dann doch über
Gefühle. Über seine Hilfslosigkeit, sich gegen die hämischen Berichte
zu wehren, wonach sich eine internationale Menschenrechtsschikeria die
Klinke in die Hand gebe, um "Hollywoods Lieblingsmörder" zu besuchen.
Über seine Einsamkeit und die Überwindung, die es kostet, statt den Fernseher
in der Zelle anzuschalten und sich "von bunten Bildern betäuben zu lassen",
einen Artikel über die Geschichte der Black Panther zu schreiben. "Handschriftlich,
ohne Schreibmaschine."
Seit der Veröffentlichung seines Buches »Live aus der Todeszelle« ist
Abu-Jamal zur Symbolfigur der Todesstrafengegner avanciert. Er habe manchmal
den Eindruck, dadurch zur Projektionsfläche für unterschiedlichste politische
Ambitionen geworden zu sein, sagt er. "Kongreßabgeordnete wollen Stimmen
gewinnen, indem sie meine Hinrichtung fordern. Für andere bin cih ein
Symbol, aber kein Mensch mit Hoffnungen und Ängsten." Mit einer energischen
Geste schüttelt er die an den Schläfen ergrauten Dreadlocks aus dem Gesicht.
Seine größte Angst? "Dass meine Unterstützer denken, meine sogenannte
Prominenz würde mich davor schützen, hingerichtet zu werden. Dem Gouverneur
ist es todernst, mich umzubringen."
Am Tag nach dem Besuch erfährt Abu-Jamal von der Ablehnung seines Antrags
beim Obersten Gerichtshofs in Washington, die von seinen Anwälten vorgebrachten
Verletzungen seiner Verfassungsmäßigen Rechte als Präzedenzfall anzuhören.
Eine Woche später unterzeichnet Pennsylvanias Gouverneur Thomas Ridge
mit zwei weiteren Hinrichtungsbefehlen auch den von Abu-Jamal. Als Hinrichtungsdatum
ordnet er den 2. Dezember 1999 an.
Für Abu-Jamal ist es das zweite Mal, dass sein Tod auf den Tag genau festgelegt
ist. Der erste Hinrichtungsbefehl wurde 1995 zehn Tage vor dem Exekutionstermin
ausgesetzt, weil seine Berufungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft waren
und internationale Proteste den Fall begleiteten. 68 Tage hatte Abu-Jamal
damals in der sogenannten Phase Zwei verbracht. Detailliert beschreibt
er, was ihn auch in den kommenden Wochen erwartet. "Alle zehn Minuten
kommt ein Aufseher, um zu kontrollieren, daß ich mich nicht umbringe.
Das Licht wird nie ausgeschaltet. Die Post wird einbehalten. Der wöchentliche
15minütige Telefonanruf ist gestrichen. Nur mein Anwalt und engste Angehörige
dürfen mich besuchen."
 Abu Jamal hofft, dass ein Bundesrichter den Hinrichtungsbefehl auch dieses
Mal aussetzt. Noch bleiben ihm zwei Berufungsinstanzen auf der Bundesgerichtsebene,
die über den Antrag auf Wiederaufnahme seines Verfahrens entscheiden müssen.
"Mein Mandant ist unschuldig", sagt Bürgerrechtsanwalt Leonard Weinglass,
der Abu-Jamal seit zehn Jahren vertritt. "Aber um das zu beweisen, braucht
er einen neuen Prozeß." Die Chancen dafür beurteilt er skeptisch. Ein
1996 zur schnelleren Umsetzung der Todesstrafe verabschiedetes erlaubt
den Bundesrichtern die Revision von Urteilen aus den unteren Instanzen
nur noch, wenn diese auf einer "unmäßigen" Verletzung von verfassungsgeschützten
Rechten der Verurteilten basieren. Wurden vorher rund 35 Prozent aloler
Todesurteile von den Bundesrichtern aufgehoben, so ist diese Möglichkeit
heute stark eingeschrängt. Auch wenn der Oberste Gerichtshof in Washingtion
in einem Präzedenzfall gerade mit Anhörungen zu der Frage begonnen hat,
welcher Spielraum sich hinter dem Begriff "unmäßig" verbirgt, verbietet
sich Abu-Jamal allzu große Hoffnungen: "Momentan gibt es keinen obersten
Richter mehr, der grundsätzlich gegen die Todesstrafe ist".
Abu Jamal hofft, dass ein Bundesrichter den Hinrichtungsbefehl auch dieses
Mal aussetzt. Noch bleiben ihm zwei Berufungsinstanzen auf der Bundesgerichtsebene,
die über den Antrag auf Wiederaufnahme seines Verfahrens entscheiden müssen.
"Mein Mandant ist unschuldig", sagt Bürgerrechtsanwalt Leonard Weinglass,
der Abu-Jamal seit zehn Jahren vertritt. "Aber um das zu beweisen, braucht
er einen neuen Prozeß." Die Chancen dafür beurteilt er skeptisch. Ein
1996 zur schnelleren Umsetzung der Todesstrafe verabschiedetes erlaubt
den Bundesrichtern die Revision von Urteilen aus den unteren Instanzen
nur noch, wenn diese auf einer "unmäßigen" Verletzung von verfassungsgeschützten
Rechten der Verurteilten basieren. Wurden vorher rund 35 Prozent aloler
Todesurteile von den Bundesrichtern aufgehoben, so ist diese Möglichkeit
heute stark eingeschrängt. Auch wenn der Oberste Gerichtshof in Washingtion
in einem Präzedenzfall gerade mit Anhörungen zu der Frage begonnen hat,
welcher Spielraum sich hinter dem Begriff "unmäßig" verbirgt, verbietet
sich Abu-Jamal allzu große Hoffnungen: "Momentan gibt es keinen obersten
Richter mehr, der grundsätzlich gegen die Todesstrafe ist".
Kritiker werfen Abu-Jamals Unterstützern vor, angesichts der noch ausstehenden
Berufungsmöglichkeiten, sei "die Panikmach" wegen des Hinrichtungsbefehls
völlig unbegründet. Abu Jamal verweist dagegen auf die Politik des Gouverneurs:
Auf Nachfrage sagt dessen Pressesprecher Tom Childs offen: "Dem Gouverneur
geht es darum, die Gefangenen dazu zu zwingen, ihre Berufungsschritte
aufzubrauchen und die langen Wartezeiten bis zur Hinrichtung zu verkürzen."
Bisher habe Ridge 171 Hinrichtungsbefehle unterschrieben. Drei weiße Todeskandidaten
wurden mit einer tödlichen Giftspritze in den staatlich angeordneten Tod
geschickt.
Vor vier Jahren, nachdem der erste Hinrichtungsbefehl aufgehoben wurde,
habe er mit einem Fernstudium der Psychologie begonnen, erzählt Abu-Jamal.
Das handschriftliche Manuskript hat er vor kurzem zum Abtippen "nach draußen"
geschickt. Ob ein Bundesrichter seinen Hinrichtungsbefehl aussetzen und
es dann noch Monate oder Jahre duern wird, bis die letzten Berufungsinstanzen
durchlaufen sind, darüber will er nicht spekulieren. "Meine Zeit läuft
ab", sagt Abu-Jamal.
|